
Sollten wir uns vom "Heidentum"
verabschieden ?

Sollten wir uns vom "Heidentum"
verabschieden ?
I.
Als ich Anfang der Achtziger Jahre
die ersten "Heiden" kennenlernte, waren die Hoffnungen auf einen Beitrag
der heidnischen Bewegung zur Veränderung des gesellschaftlichen Lebens
noch nahezu grenzenlos. Eine zweifache Befreiung der Heiden und aller anderen
Menschen schien sich anzukündigen, die von einem allgemeinen Aufschwung
der New-Age-Euphorie getragen wurde: Einmal die Loslösung von einer
zweitausendjährigen Epoche kirchlicher Unterdrückung, die mit
einer Wiedergeburt uralter vorchristlicher Kulturen Europas einherzugehen
schien.
Und zum andern die Überwindung
der schädlichen Folgen einer technischen und städtischen Zivilisation,
die in unserer Empfindung als Barriere zwischen dem Menschen und einer
"reinen" und "ursprünglichen" Natur erwachsen war.
Wir werden uns nun, nach nahezu
zwanzig Jahren, die Frage stellen dürfen, was aus all diesen Hoffnungen
geworden ist. Und wenn wir das betrachten, was sich uns als Realität
unseres Lebens, der Kultur und Politik darbietet, gewinnen wir keinen besonders
günstigen Eindruck.
Unser Eindruck von der Welt, wie
sie sich seitdem entwickelt hat und von der Rolle der "heidnischen Bewegung"
darin ist eher katastrophaler Natur.
Schauen wir uns in Form einer persönlichen
Momentaufnahme zunächst einmal diese Bewegung an, die vielleicht nie
eine war.
Vor rund 15 Jahren in Berlin, wo
ich mit verschiedenen Leuten eine heidnische Gruppe gründete, waren
darunter die Vertreter der verschiedensten heidnischen Richtungen. Es waren
Anhänger einer germanischen Religion, die sich ihre Weisheit aus der
Edda holten. Es waren völkische Heiden, die bemüht waren, ihrer
faschistischen Ideologie eine spirituelle Unterfütterung zu verpassen.
Es waren Leute, die sich für volkstümliches Brauchtum interessierten
und es waren Menschen, die sich einer alten Religion der Hexen verbunden
fühlten. Als wir gemeinsam ein Ritual der Wintersonnenwende zelebrierten,
das von einem Exponenten des Hexenkults geleitet wurde, kam es zum Eklat.
In diesem Ritual hatte er sich mit einem Gott aus der germanischen Mythologie
identifiziert und diese Form von Einswerdung auch sehr dramatisch und lebendig
zum Ausdruck gebracht.
Der Vorwurf lautete auf Blasphemie,
die in der "Anmaßung" einer solchen Identifikation läge und
wurde in einem sich sofort in zwei Lager formierenden Auditorium sowohl
bekräftigt als auch heftig befehdet.
Die zwei Grundeinstellungen, die
in dieser Fehde zum Ausdruck kamen, sind kurz umschrieben: Während
die Einen eher ein mystisches Verhältnis von größter Nähe
zu den alten Göttern erstrebten, standen die andern in starrer Unterwürfigkeit
verbunden mit allergrößter Angst vor den Folgen ihres Frevels
vor jenen Gestalten.
Am Schlimmsten war der Vorwurf,
der gerade sehr strenge Winter, bei dem Temperaturen von weit unter Minus
20 Grad herrschten, und bei dem einige alte Leute in ihren Wohnungen erfroren
waren, sei die direkte Auswirkung dieses frevelhaften Rituals gewesen.
Am Ende bleiben in der Gruppe all jene übrig, die genügend
Energie für formalistische Intrigen und Rituale der Rangordnung übrig
hatten. Sie monopolisierten den Begriff des Heidentums und bemühen
sich heute noch darum, den "Willen der Götter" aus den verschimmelten
Manuskripten einer als Edda bezeichneten mittelalterlichen Schrift herauszudestillieren.
Ungefähr zwölf Jahre später versammeln sich Mitglieder einer heidnischen Organisation in einer Jugendherberge, die sich in einer alten Burg im Sauerland befindet. Ein paar Dutzend junger Leute zwischen zwanzig und Dreißig treffen sich dort, wobei einige von ihnen, in wallende Gewänder gehüllt, als germanische Priester (sogenannte "Goden") und einige als keltische Weise, genannt Druiden, auftreten, während andere sich als Anhänger der Religion der Hexen hervortun. Das Treffen ist der letzte Punkt einer Reihe von Streitereien und Hahnenkämpfen um die Macht in der Gruppe, wobei sich die Anhänger der "Germanen" und "Kelten" besonders hervortun. Während die Hexen und Hexer, zumal in ihrer Eigenschaft als "Freifliegende" eher einen spielerischen und undogmatischen Umgang mit ihrer Religion pflegen, zeichnen sich die Goden und Druiden durch einen besonders strengen Legitimationsanspruch aus, der ihnen einen dünkelhaften Machtanspruch verleiht. In diesem Fall kommt es zu einer Machtprobe, bei der sich die "Anhänger der Kulturen" der Germanen und Kelten durchsetzen. Hexen und Hexer verlassen großenteils die Gruppe - überdrüssig der ständigen Drohgebärden und Intrigenspiele.
Das Unheimliche an diesen Geschehnissen
liegt nicht allein in ihnen selbst, sondern in der Kontinuität bestimmter
Verhältnisse zwischen autoritärem Gehabe und mystischer Anarchie.
In jener Burg im Sauerland traten junge Menschen von Anfang zwanzig als
Wortführer uralter Kulturen auf, die letztendlich das gleiche Verhalten,
gleichsam aus sich selbst hervorbringend, an den Tag legten, wie ihre Berliner
Protagonisten ein Jahrzehnt zuvor.
Es wird nicht im Unklaren bleiben,
wem wir bei diesen Religionskriegen en miniature eher unsere Sympathie
und Antipathie entgegenbringen. Das Schlimme an diesen "Wiedergeburten"
der Vergangenheit, ob wir jetzt die Goden oder die Hexen betrachten, ist
zweierlei: Einmal kündet ihre Pathologie der Selbstbehauptung von
einer unsicheren Identität. Es sind keine Wiedergeburten von irgendetwas,
was es historisch wirklich einmal gab. Es sind vielmehr monströse
Mißgeburten menschlicher Gedanken und innerer Bilder ins Stoffliche
hinein. Materialisationen von Bildern, die Zeugnis ablegen von den Vorstellungen,
die von der Vergangenheit entwickelt wurden.
Die Uneinigkeit der heidnischen
Bewegung in sich selbst, ihre innere Unklarheit - das Gärungshafte
ihres eigenen bisherigen Werdeganges spiegelt zugleich die Unfähigkeit
wider, unserer Welt bei irgend einer ihrer zentralen zeitgenössischen
Probleme wirkliche Hilfestellung zu gewähren.
Dafür garantiert das mangelnde
Profil ihres intellektuellen Konzepts ebenso, wie die gesellschaftliche
Wirkungslosigkeit ihres sozialen Erscheinungsbildes.
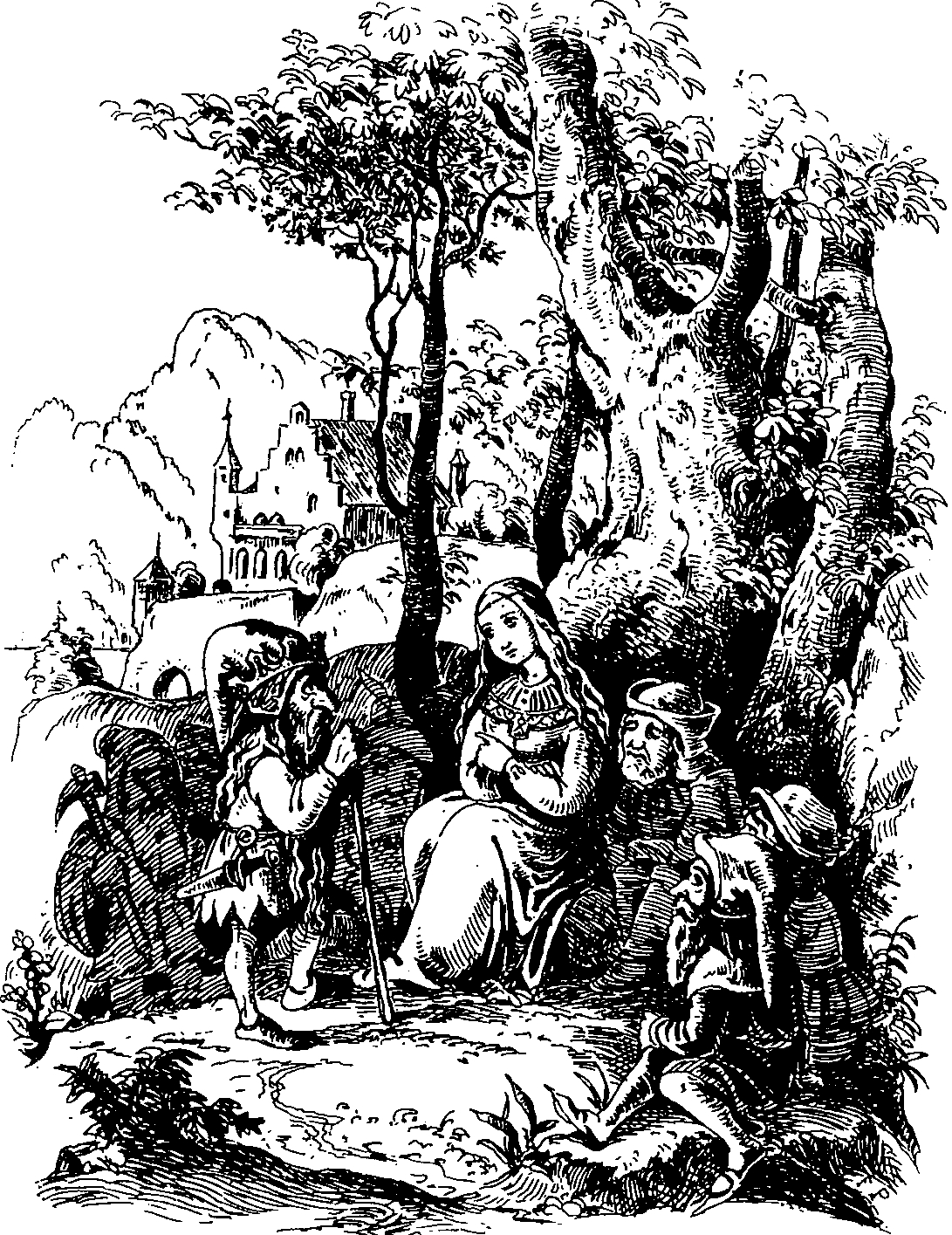
II.
Und andererseits führt die
Konfrontation mit der alten heidnischen Hoffnung auf eine Durchsetzung
der Natur gegen die Zivilisation (s.o.) zu folgender düsterer Bilanz:
Statt sich der Natur anzunähern, haben die uns bekannten Heidentümer
vor allem an der Herausarbeitung von mythologischen Scheinwelten gearbeitet,
in denen man sich beliebig bewegen kann, was immer auch mit dieser Welt
geschehen mag.
Ob ich nun an die Götter der
alten Germanen denke oder die Große Göttin feministischer Kulte
oder das Paar von Göttin und Gott - klar ist, daß es sich bei
all dem um sekundäre Widerspiegelungen innerhalb der Psyche handelt,
aber nicht um eine klare und offene Auseinandersetzung mit der Welt, die
uns umgibt. Glück haben wir noch, wenn die Gläubigen dieser Bilderwelten
zugestehen, daß es sich bei ihnen um Geschöpfe der Imagination
handelt. Aber meistens erwartet man von uns, daß wir diesen eine
imaginäre Überwelt bevölkernden Gestalten einen eigenständigen
Realitätscharakter zubilligen.
Das Paradox des Heidentums ist
es, einerseits eine Naturreligion sein zu wollen, und andererseits die
wirkliche Natur durch sie symbolisierende Bilder mythologisch zu verschlüsseln
und zu verschleiern, dem natürlichen Wahrnehmen und Erleben unerkennbar
zu machen.
Damit ist - bei wirklich ehrlicher
Überlegung - ein Traum aller heidnischen Menschen der letzten
dreihundert Jahre zerbrochen, die darauf ihre Hoffnung setzten, eine Alternative
zur christlichen Lebensverneinung und Jenseitsgläubigkeit zu erreichen.
Denn der Hauptvorwurf gegenüber dem Christentum galt bisher stets
zu Recht, daß dieses seine Anhänger um die wirkliche Welt und
das wirkliche Leben betrüge, indem es sie auf eine unbegreifliche,
zukünftige und hinter den Dingen liegende Welt verweise.
Eine Hauptschuld für diese
untergründige Deformierung des Neuheidentums gerade zum Zeitpunkt
seiner Manifestation ist im Grunde die große Verbreitung des Okkultismus.
Der grandiose Irrtum der Achtziger Jahre bestand u. a. darin, daß
die Philosophie des New Age eine völlig neue Sichtweise der Dinge
gewährleiste, die es noch nie zuvor gegeben habe. In Wirklichkeit
war es die Wiederkehr der alten dualistischen Transzendentallehre, die
das "Eigentliche" außerhalb des handgreiflich Sinnlichen und Wirklichen
postulierte. Der Okkultismus in all seinen Varianten, ob in Form der dämonologischen
Magie, der mesmerischen Hypno-Hysterie oder dem Spiritismus - bis
zu seinem jüngst geborenen Monstrum, dem Channeln, hat noch stets
seine Aufgabe hervorragend erfüllt: In unbewußter Selbsttäuschung
scheinbare Alternativen zum Christentum zu eröffnen, in denen sich
dieses untergründig wieder herbei schleichend und mit verstellter
Stimme redend erneut stabilisierten konnte.
Das herausragende Charakteristikum
der alten Naturreligionen bestand in der Faszination gegenüber den
Phänomenen der den Menschen umgebenden Welt. Das Neuheidentum in seiner
im Hexenkult zum Ausdruck gelangenden Version hingegen beginnt der christlichen
Theologie Konkurrenz zu machen, indem es an einer abstrakten, metaphysischen
Theologie zu feilen beginnt. So belehrt uns etwa Starhawk: "Die Betrachtung
des Alls als Energiefeld, das von zwei starken Kräften polarisiert
wird - dem Männlichen und dem Weiblichen, der Göttin und dem
Gott, die in ihrer höchsten Seinsform Aspekte voneinander sind -,
ist nahezu allen Überlieferungen der Hexenreligion gemeinsam." (Starhawk:
Der Hexenkult als Ur-Religion der Großen Göttin, Freiburg i.Br.1987,
S.47). Und Vivianne Crowley, eine britische Interpretin des Wicca-Kults
klärt den Suchenden folgerndermaßen über das Wesen der
Kräfte auf: "Wie unsere Vorfahren gehen wir im Wicca davon aus, daß
bestimmte natürliche Phänomene eine eigene Form des Bewußtseins
besitzen, doch tendiert man heute eher dazu, die Geister, die in Bäumen,
Höhlen oder Seen anzutreffen sind, nicht als Gottheiten, sondern als
elementare Kräfte anzusehen,, die auch als Devas oder Naturgeister
bekannt sind. ...Die Devas sind jene Wesen, die die Arbeit für die
planetare Gottheit ausführen". (Vivianne Crowley: Wicca - Die Alte
Religion im Neuen Zeitalter, Bad Ischl 1993, S. 159). Noch stärker
löst sich Heide Göttner-Abendroth von der Konkretheit der Natur
ab, obwohl sie sich doch als Feministin der Rolle der Abstraktion für
die Entwertung des "Stofflichen" durch den patriarchalischen "Geist" bewußt
sein sollte: "Die Mythologie matriarchaler Gesellschaften besteht aus Göttin-Mythensystemen,
wobei die Urgöttin die Erde oder der Kosmos selber ist. ... Diese
dreifaltige Göttin ist nichts geringeres als die Schöpferin,
die Erhalterin, die Zerstörerin und Neuschöpferin der Welt, verkörpert
im Bild der unaufhörlich kreativen weiblichen Kraft". (Heide Göttner-Abendroth:
Für die Musen, Frankfurt a.M. 1992, S.28f.)
Und das traditionalistische Heidentum
? Auch die Goden und Druiden nehmen ganze mythologische Systeme en bloc
in ihren Glaubenskanon auf, um sich dann händeringend zu fragen, welche
Naturkraft denn nun ein Gott wie Odin, Teutates oder Hermes verkörpern
mag. Dabei übersehen sie leider, daß manche Gottheiten nicht
bestimmte Naturkräfte, sondern gesellschaftliche Funktionen verkörpern:
Den Stammeshäuptling, den Krieger, den Schmied oder den Hirten. Nun,
das Gefühl, unsere Religion mit einem Panoptikum untergegangener Berufe
zu verbinden, erscheint mir nicht gerade besonders zukunftsfroh.
III.
Schauen wir uns jetzt noch eine
Vision an, die in der Morgendämmerung der Neuzeit eine große
Rolle gespielt hat: Die Sehnsucht der Menschen nach einer Freiheit der
Selbstentfaltung, die das Zeitalter der Feudalherrschaft wie auch der kirchlichen
Priesterhierarchien ein für alle mal beenden sollte. Was ist daraus
geworden ?
Blicken wir in die heidnische Bewegung
hinein, so begegnen wir allerorten kleinen Herrschern und Herrscherinnen,
die in keiner Weise um Legitimationen verlegen sind: Stammespriester, Oberdruiden,
Verwalter von Heiligtümern, Hohe Priester höchsten Grades, ehrwürdige
Vertreter uralter Familientraditionen und jahrtausendealter Dauerüberlieferungen.
Wie in der Kirche Roms treten sie auf als Stellvertreter höchster
Wesen und spenden durch Einweihungen Sakramente, deren der Neophyt durch
eigene Anstrengung nicht teilhaftig zu werden vermag. Während die
priesterlichen Strukturen im Hexenkult auf die Traditionen freimaurerischer
Logen und Orden zurückgehen, welche sich wiederum aus den Mysterien
der Leviten und der mittelalterlichen
Ritterorden ableiten, führen traditionalistische Druiden und Goden
historische Quellen zur Rechtfertigung ihrer Privilegien an. Doch auch
sie vermögen nicht unsere geschichtliche Erfahrung zu verändern,
welche uns darüber aufklärt, daß das Ständesystem
der Indoeuropäer diese zum Mißbrauch des Ritter- und Königtums
bis hin zum menschenschindenden mittelalterlichen Feudalismus veranlaßte.
IV.
Was aber sollten wir nun tun ? Dem
Nihilismus oder Atheismus verfallen und vom Balkon springen ? Zunächst
einmal könnten wir in der Welt, in der wir leben, zwischen sinnlich
begreifbarer Wirklichkeit und unseren menschlichen subjektiven Bedürfnissen
unterscheiden. Eine Landschaft mit einem Berg oder Fluß darin, ein
Baum in einem Stadtpark oder der Mond am Himmel - das sind Wirklichkeiten,
denen wir uns aussetzen können, um sie mit all unseren Sinnen zu erfassen.
Es ist wahrscheinlich immens wichtig, diese für unsere Zivilisation
unbedeutenden Wirklichkeitsformen neu wahrnehmen zu lernen, ihnen so gegenüber
zu treten, daß nichts dazwischen zu treten vermag. Jedenfalls erscheint
mir das wichtiger, als unsere innere Wahrnehmung zulasten der äußeren
zu verstärken und diese dann mit allen möglichen Bildern aus
allen Zeiten und Ländern zu verstopfen.
Übung Nr. 2: Die Kategorien
des eigenen Seins, also unsere wichtigsten emotionalen Erlebens- und Bewußtseinsformen
zu betrachten und ihnen dann vielleicht im Rahmen einer persönlichen
Mythologie Ausdruck zu verleihen. Wer den Mut dazu hat, wird feststellen,
daß die daraus hervorgehende Religion von unvergleichlicher Einzigartigkeit
sein wird. Nur zu einem müßtest Du in der Lage sein, um diesen
Weg zu gehen: Nicht darauf angewiesen zu sein, daß andere Dich in
Deinem Tun bestärken.
Matthias Wenger
Empfehlenswerte Literatur:
Abaris: Neue Naturreligion, Berlin
1994, in: der Hain - Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und
thelemitische Philosophie
Diane Ackerman: Die schöne
Macht der Sinne, München 1993
Epikur: Von der Überwindung
der Furcht, übersetzt und eingelweitet von Olof Gigon München
1991
Ernst Fuhrmann: Was die Erde will,
München 1986
Brüder Grimm: Kinder- und
Hausmärchen, München 1984
Joel Kramer & Diana Alstad:
Die Guru Papers - Masken der Macht, Frankfurt a.M. 1995
Laudse: Daudedsching, übersetzt
und herausgegeben von Ernst Schwarz, Leipzig 1990
Harold Lincke: Instinktverlust
und Symbolbildung, Berlin 1981
Herbert Marcuse: Triebstruktur
und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1995
Michel Onfray: Der sinnliche Philosoph,
Frankfurt a.M. 1992
Die Vorsokratiker I und II, übersetzt
u. herausgegeben von Jaap Mansfeld, Stuttgart 1995